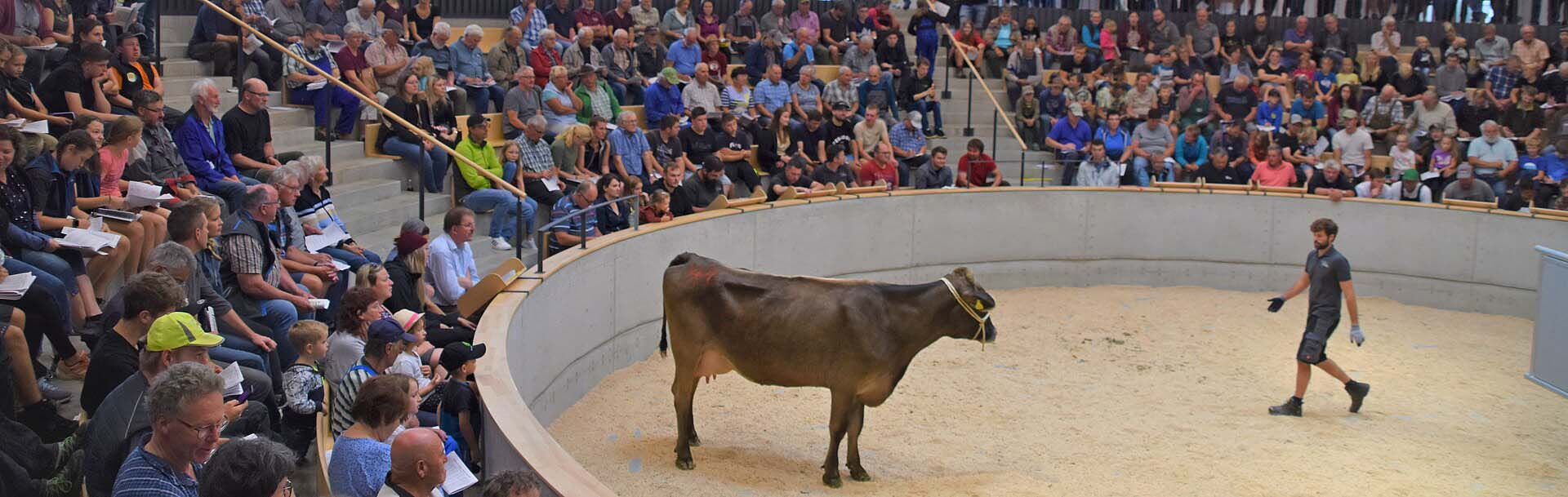GESCHICHTE
Geschichte der Allgäuer Herdebuchgesellschaft (AHG)
Mit über 125 Jahren eine der ältesten Zuchtorganisationen in Deutschland, wurde die AHG Ende des 19. Jahrhunderts in einer Zeit gegründet, in der die Allgäuer Milch- und Viehwirtschaft arg in Bedrängnis war. Ursprünglich hatten sich im Laufe der Jahrhunderte im Alpenraum unterschiedliche Braunviehschläge gebildet. Die bekanntesten waren der Montafoner, der Schweizer, der Lechtaler, der Oberinntaler und der Allgäuer Schlag - auch als „Allgäuer Dachs“ bezeichnet. Letzterer war zwar der kleinste und zierlichste, zeichnete sich aber durch die höchste Milchergiebigkeit aus und war darüber hinaus aufgrund seiner Genügsamkeit, Gesundheit und Langlebigkeit geschätzt. Anfang des 19. Jahrhunderts erlebte er seine größte Blütezeit und fand im süddeutschen Raum und darüber hinaus sowie bis nach Oberitalien seine Verbreitung. Geschätzt waren auch die Zug- und Mastochsen, wobei in der Regel die besten Tiere abgesetzt wurden. Dieser lebhafte Handel führte schließlich dazu, dass wichtige Zuchttiere fehlten. Die Lücke wurde durch die Einfuhr von Tieren anderer, weniger leistungsfähiger Schläge aus Österreich und der Schweiz geschlossen.

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde auch die Rinderpest ins Allgäu eingeschleppt und große Teile der Viehbestände fielen ihr zum Opfer. In der Not wurden darüber hinaus die guten Tiere verkauft und ebenfalls durch Tiere anderer Schläge ersetzt, so dass schließlich ein Wirrwarr verschiedener „Rassen“ entstand. Als dann ab 1830 die Milchwirtschaft im Allgäu aufblühte und sich stark ausweitete, trat die Milchproduktion direkt in Konkurrenz zur Viehaufzucht. Letztere wurde vernachlässigt und stattdessen Kühe zur Milcherzeugung gehalten. Das erforderliche Melkvieh wurde wiederum im benachbarten Ausland zugekauft. Die Zucht von eigenem, leistungsstarkem Vieh geriet dadurch immer mehr in Bedrängnis und es war höchste Zeit zu retten, was noch zu retten war. Für den ursprünglichen „Allgäuer Dachs“ war es aber bereits zu spät. Fallende Milchpreise unterstützten letztendlich ein gewisses Umdenken. Initiiert durch Baurat Josef Widmann und weitblickende Weggefährten erfolgte schließlich am 15. November 1893 in Kempten die Gründung der Allgäuer Herdebuchgesellschaft.

Forciert und unterstützt wurde seinerzeit nicht nur die gezielte Einfuhr von guten Zuchtstieren aus der Schweiz, sondern auch die Aufzucht von Jungvieh. Hierzu pachtete und erwarb die Allgäuer Herdebuchgesellschaft schon bald nach ihrer Gründung mehrere Alpen für die Sömmerung von Jungvieh an. Mehr als 10 Alpen kamen in den letzten Jahren des ersten Weltkrieges hinzu. Aus diesem Grund befinden sich noch heute zahlreiche Alpen im Besitz der Allgäuer Herdebuchgesellschaft und dienen der Älpung von Jungvieh aus Mitgliedsbetrieben. Durch die starke Zunahme der Mitgliederzahl erfolgte bereits 1919 die Eröffnung einer Zweigstelle der AHG in Kaufbeuren, die 1947 zu einer selbständigen Verbandsabteilung wurde. Der Hauptsitz der Allgäuer Herdebuchgesellschaft ist seit 1937 in Kempten, zuvor war dieser in Immenstadt. Seit 2002 sind die zuvor getrennten Kassen der beiden Verbandsabteilungen wieder zusammengelegt. Am 28.10.2011 fand eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, bei der die Auflösung der beiden selbständigen Abteilungen Kempten und Kaufbeuren beschlossen wurde und gleichzeitig die Zusammenführung in einem Haus in Kempten. Im Oktober 2012 wurde dieser Zusammmenschluss dann vollzogen und es besteht nur noch ein Verwaltungssitz in Kempten. Gelenkt werden die Geschicke der AHG heute vom Vorsitzenden und seinem Stellvertreter, der sechsköpfigen Vorstandschaft, den 22 stimmberechtigten Ausschussmitgliedern, der Mitgliederversammlung sowie dem Zuchtleiter und seinem Stellvertreter. Im Juli 1900 wurde durch das Bayerische Staatsministerium, Abteilung Landwirtschaft, die Urkunde der Rechtsfähigkeit an die Allgäuer Herdebuchgesellschaft verliehen.

Geschichte des Zuchtverbandes Schwarzbunt und Rotbunt Bayern e.V. (SRB)
Der Zuchtverband Schwarzbunt Bayern wurde 1954 ebenso wie der Verband Bayerischer Rotbuntzüchter in München gegründet. 1992 wurden beide Verbände zum Zuchtverband Schwarzbunt und Rotbunt Bayern (SRB) fusioniert. Ziel war die Förderung der Zucht der milchbetonten Holsteinkuh in den Farbrichtungen Schwarzbunt und Rotbunt. Holsteins bzw. damals die deutschen Schwarzbuntkühe stammen ursprünglich aus den Regionen der Nordseeküste Deutschlands und Hollands und wurden Ende des 19. Jahrhunderts nach Nordamerika exportiert. Dort wurde eine deutlich milchbetontere als in Europa mit sehr viel besseren Euterqualitäten weiterentwickelt. Durch den Import von nordamerikanischer Genetik in Form von Lebendtieren, Sperma und Embryonen erfolgte zu Beginn der 1960er-Jahre eine mehr oder weniger komplette Umzüchtung der nordeuropäischen Schwarzbunt- und Rotbuntkühe zur modernen deutschen Holsteinkuh.
Parallel zur Schleißheimer Zucht importierte der aus Ostpreußen stammende Louis Le Tanneux von Saint Paul 1964 sechs Original-Holstein-Friesian Kühe aus Kanada in seinen Betrieb bei Seeseiten am Starnberger See. Sein Import des Bullen ldeal 94291 aus der amerikanischen Zimmermannherde wie auch schon Primo brachte in Bayern den Durchbruch in Sachen Holsteinisierung. Zahlreiche hochpositive Söhne von Ideal und Primo brachten Bayern in eine Führungsposition bezüglich der klaren züchterischen Ausrichtung auf eine stärker milchbetonte Kuh.
Die Holsteinkuh ist die heute weltweit am stärksten verbreitete Milchrasse und absolut führend in der Milchleistung. Insbesondere große spezialisierte Milchviehhalter setzen auf die Eigenschaften sichere Leistungsveranlagung, beste Euterqualität, sehr gute Umgänglichkeit und beste Futtereffizienz. Die Holsteinzucht hat die genomische Selektion als erste Rasse eingeführt und fest in den Zuchtprogrammen etabliert. Und neben den klassischen Merkmalen Leistung, Exterieur, Nutzungsdauer liegt heute ein Schwerpunkt der Selektion auf den Gesundheitsmerkmalen. Der Relativzuchtwert Gesund der deutschen Holsteinzucht kann als Meilenstein in der weltweiten Holsteinpopulation gesehen werden.